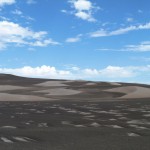Zurück auf der Panamericana geht es durch die trockene Küstenwüste nach Ica, bekannt für seine Weinkellereien, Dattelpalmen und den Anbau von Mangos und grünem Spargel, der zum größten Teil exportiert wird, da die traditionelle peruanische Küche ihn nicht kennt.

Die Oasenstadt liegt am Rand der höchsten Sanddünen Amerikas und hat ein sonniges, sehr heißes Klima. Auch hier sieht man noch immer die Spuren der schweren Verwüstungen des Erdbebens von 2007 mit der Stärke 8.0, bei dem in der Region Pisco rund tausend Menschen starben und 75.000 Häuser zerstört wurden. Auch entlang der PanAm verlaufen heute noch sichtbare große Verwerfungen.
Die kilometerlangen Geoglyphen von Nasca, deren Sinn und Herkunft bis heute von Archäologen nicht abschließend geklärt werden konnte, lassen wir links liegen, vielmehr durchschneiden sie, denn die PanAm führt durch den Schwanz der Eidechse hindurch.
Unterwegs sehen wir viele Streckenposten der Polizei, die uns aber immer freundlich durchwinken. Trotz der vielen Kontrollen trägt die PanAm in Südamerika den Namen „Carretera Criminal“, da es immer wieder zu brutalen Raubüberfällen kommt. Die Täter provozieren Unfälle und rauben dann die Opfer aus oder tarnen sich als falsche Polizisten. Nachtbusse auf der Strecke fahren inzwischen in Konvois von neun oder zehn Fahrzeugen, da die Täter selbst vor den Reisebussen nicht halt machen. Wir versuchen, Nachtfahrten soweit wie möglich zu vermeiden, zumal wir mit dem Mog nicht die Schnellsten sind.

Hinter endlosen Kilometern in menschenleerer Wüsteneinsamkeit trifft die PanAm bei Puerto Lomas wieder aufs Meer und fast unberührte Strände. An der Mündung des Rio Yauca finden sich im gleichnamigen Ort unerwartet ausgedehnte grüne Haine mit knorrigen Olivenbäumen. Hinter dem kleinen Fischerort Chala führt die Traumstraße, die ihren Namen hier zu Recht trägt, dann hoch über dem grau-blauen Ozean eine spektakulären Steilküste entlang.
Für diese Teilstrecke der PanAm sollte man schwindelfrei und kein Hasenherz sein. Die kalten Wellen des Pazifik türmen sich meterhoch und brechen mit gewaltigem Donnern auf den Sandstrand direkt unter uns. Viele Pelikane und Raubvögel sind zu sehen, auch einen gestrandeten Wal entdecken wir am Strand. Die PanAm schraubt sich viele Hundert Meter hoch, eng an die Bergflanke geschmiegt, und wenn in einer Haarnadelkurve plötzlich ein schwer beladener Truck auf der eigenen Fahrbahn entgegenkommt, weil er mit zu hoher Geschwindigkeit aus der Spur getragen wurde oder weil er den Platz benötigt, um seine Fracht um einen Felsüberhang zu befördern, ja dann gibt’s auch mal kurzzeitig einen deutlich beschleunigten Herzschlag und Stress im Cockpit, denn einen knappen halben Meter weiter rechts geht es senkrecht ganz schnell nach unten. Es gibt’s nichts, was den Fall aufhalten könnte. Die Überlebenschance ist gleich Null: Wer sich bei dem Sturz noch nicht das Genick gebrochen hat, ertrinkt unten im Pazifik. Es ist erschreckend, wie viele der kleinen mit filigranen Kreuzen und Plastikblumen geschmückten Gedenkhäuschen die PanAm auf diesem Streckenabschnitt säumen. Das Foto habe ich vom Beifahrersitz aus während der Fahrt gemacht…

Trotzdem, wir genießen die Fahrt entlang der Küste sehr.
Wir übernachten an einer 24h Tankstelle in der Oase Ocona. Hier, an der Mündung des Rio Ocona ins Meer, wird neben vielen Gemüse- und Obstsorten sogar Reis angebaut.
Am nächsten Tag führt die Fahrt noch eine Weile die Küste entlang, bevor die PanAm dann mit schönen Blicken auf die Vulkane Misti und Chachani ins Inland Richtung Arequipa ansteigt und damit wieder für viele Stunden in öde Wüste. Hinter La Reparticion entscheiden wir uns, die PanAm zu verlassen und wieder an die Küste zu fahren, um über Mollendo und Mejia und dann weiter am Wasser entlang bis Tacna zu fahren.
Rund 50 km vor dem wichtigsten Hafen Südperus, Islay, rollt uns wieder die weiße pazifische Nebelwand entgegen, die zunehmend dichter wird, je tiefer wir uns die Serpentinen hinunter zur Küste schrauben.
Kurz vor der Mautstation Matarani oberhalb der Stadt ist die Sicht fast Null und wir überlegen, die 70 km bis zur PanAm zurückzufahren, entscheiden uns dann aber dagegen und werden mit einer Fahrt durch wunderbare Küstenstädtchen belohnt.
Über das recht große Islay/Matarani wird der gesamte Güterverkehr vom Pazifik zur brasilianischen Atlantikseite abgewickelt. Die Fracht der Schiffe wird hier auf LKW umgeladen und dann über die Titicacasee-Route nach Brasilien transportiert. Sind ja auch nur ein paar Kilometer, nur eben einmal quer rüber über die Anden. Daneben ist Islay/Matarani Freihandelszone und Hafen für … Bolivien. Das Land, das seit der Unabhängigkeit 1825 rund 200 gewaltsame Machtwechsel durchlebt hat und damit den einsamen Weltrekord hält, hatte sich neben seinen dauernden innenpolitischen Wirren auch mit all seinen Nachbarn angelegt und dabei den Kürzeren gezogen: Im Salpeterkrieg um 1880 mußte es die Region Antofagasta an Chile abtreten und verlor damit den Zugang zum Pazifik. Gute zehn Jahre später streitet es sich mit Brasilien, verliert und muß die Region um Acre abtreten. Knappe dreißig Jahre später verliert Bolivien im Chaco-Krieg das Chaco-Gebiet an Paraguay. Im Laufe der Zeit verlor Bolivien so rund 50% seines ursprünglichen Staatsgebietes. Zum Glück sind die Peruaner verträgliche Nachbarn und schlossen 1992 großzügig einen Vertrag über die bolivianische Nutzung der Pazifikhäfen Ilo und Islay.
Mangels irgendeiner Beschilderung verfahren wir uns hoffnungslos im Stadtverkehr von Mollendo und fragen zwei Polizisten in einem Streifenwagen nach dem Weg Richtung Mejia. Robert der Niro in jungen Jahren und schick bemützt sagt daraufhin, wir sollen uns keine Sorgen machen, sondern ihm einfach folgen. Es sei ihm eine Ehre, uns den Weg zu zeigen. Galanter gehts nicht. Umgehend schaltet er sein Rotlicht auf dem Dach an, ein zweiter Wagen setzt sich hinter uns und nach wenigen Kilometern in Begleitung sind wir auf die richtige Spur gesetzt. Die Fahrt über die Costanera führt uns entlang der Laguna de Mejia, einem unter Naturschutz stehenden Feuchtgebiet mit Küstenlagunen, in dem zahlreiche Vogelarten dauerhaft zuhause sind und auch viele Zugvögel überwintern.

In El Arenal wird es für uns dann langsam Zeit, einen Übernachtungsplatz zu suchen, und wir fragen widerum aus dem Auto heraus einen Polizisten, der gerade an einer Ecke ein Schwätzchen hält. Wir haben Glück: Er macht uns umgehend ganz offiziell zu Gästen der Polizei und winkt uns zum örtlichen Kommissariat durch. Einen so sicheren Stellplatz hatten wir bisher noch nie.
Am nächsten Tag ist es für unsere Verhältnisse nur noch ein Katzensprung bis Tacna und wir machen mittags noch einen Stopp in dem zur jetzigen Jahreszeit noch völlig verwaisten Badeort La Boca del Rio. Die Saison hat noch nicht angefangen, und so sind am Strand nur zwei Fischbuden geöffnet, wo wir aber fangfrische Seezunge und Chicharron de Pescado, eine Megaportion gebackener Fischfilets, essen.